
Neue Welten, neue Wahrnehmungen – Einstieg in den Expressionismus
Zielsetzung:
Die Lernenden erkennen die Merkmale des Expressionismus als eine Reaktion auf traditionelle Kunstvorstellungen und die gesellschaftlichen Umbrüche um 1900. Ziel ist die Entwicklung eines Verständnisses für die Ablehnung der bürgerlichen Ordnung und die Suche nach einem direkten, ehrlichen Ausdruck von Erfahrungen und Emotionen. Die Lernenden reflektieren, wie sich die Themen Isolation, Entfremdung, Angst und die Auseinandersetzung mit der Großstadt in expressionistischer Kunst, Musik und Literatur manifestieren, und vergleichen diese mit den dargestellten Werken und Texten.
Inhalte und Methoden:
Das Arbeitsblatt thematisiert die Entstehung und die Merkmale des Expressionismus in Kunst, Musik und Literatur. Es werden Beispiele für expressionistische Werke vorgestellt (Musik von Strawinsky, Gemälde von Meidner und Kirchner), Lückentexte bearbeitet, Gedichte analysiert und Bezüge zur historischen und gesellschaftlichen Situation hergestellt. Methoden umfassen Videoanalyse, Internetrecherche, Partnerarbeit, Lückentextbearbeitung, Textanalyse und Multiple-Choice-Aufgaben.
Kompetenzen:
- Die Lernenden identifizieren und beschreiben die Merkmale des Expressionismus in verschiedenen Kunstformen.
- Sie analysieren und interpretieren expressionistische Werke hinsichtlich ihrer Themen (z. B. Isolation, Entfremdung, Großstadt) und ihrer formalen Gestaltung.
- Sie erkennen die Bedeutung des historischen und gesellschaftlichen Kontextes für die Entstehung des Expressionismus.
- Sie setzen sich kritisch mit der Darstellung von Emotionen und Erfahrungen in expressionistischen Werken auseinander.
Zielgruppe und Niveau:
Ab Klasse 10
84 other teachers use this template
Target group and level
Ab Klasse 10
Subjects
Neue Welten, neue Wahrnehmungen – Einstieg in den Expressionismus


Expressionismus
Die Welt um 1900 war geprägt von bürgerlicher Ordnung und traditionellen Kunstvorstellungen. Doch für eine neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern fühlte sich diese Welt eng und unaufrichtig an. Sie lehnten die scheinbare Harmonie ab und suchten nach einem direkteren, ehrlicheren Ausdruck ihrer Erfahrungen. Der Expressionismus war ihr Aufschrei - eine revolutionäre Bewegung in Kunst und Literatur, die mit Konventionen brach, das Hässliche nicht scheute und die rohe, ungefilterte Emotion in den Mittelpunkt stellte.
📋 Arbeitsauftrag: Schau dir das folgende Video aufmerksam an und mache dir Notizen.
✒️ Hier findest du Platz für deine Notizen.
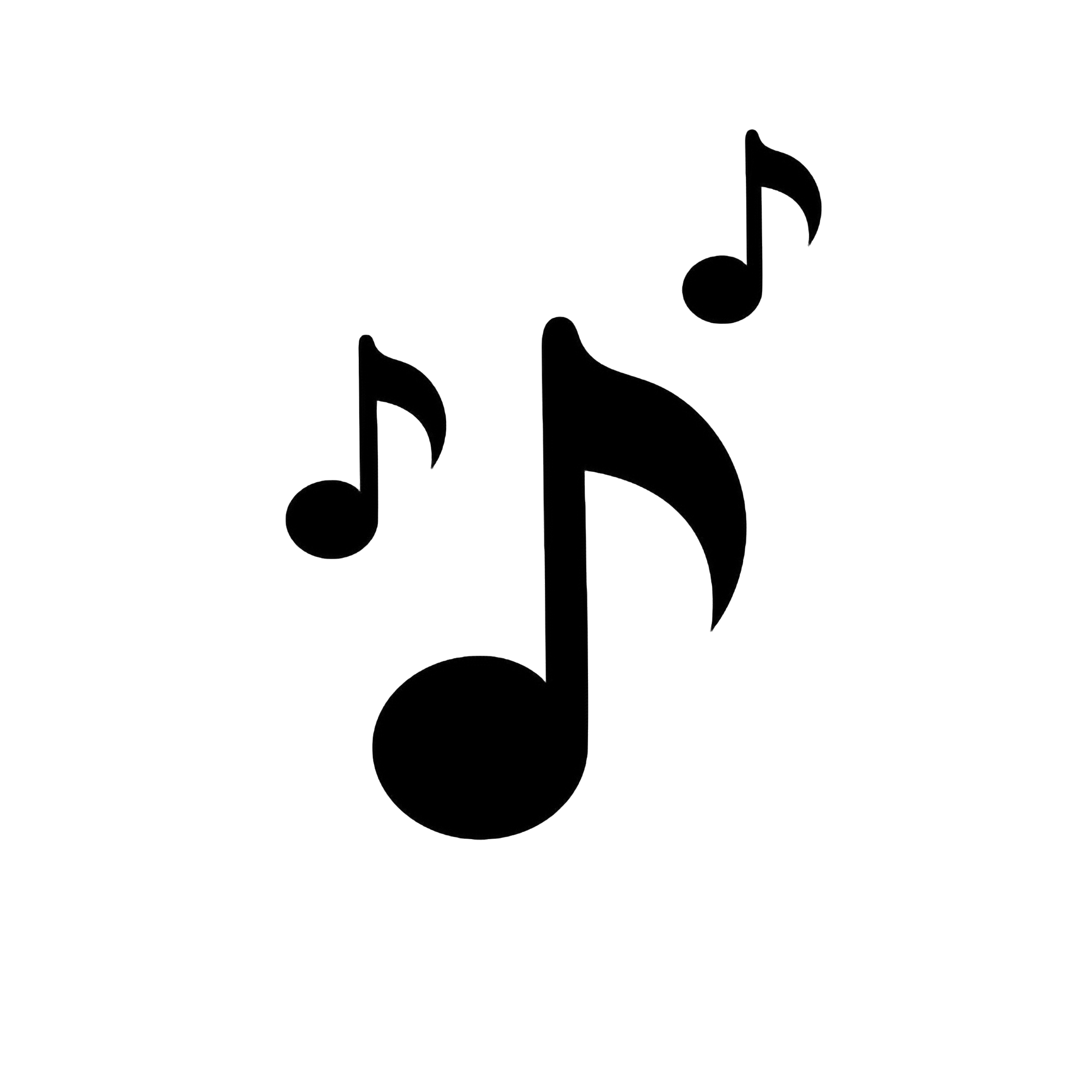
Igor Strawinsky
💡Igor Strawinsky (1882-1971) war ein einflussreicher russischer Komponist des 20. Jahrhunderts, dessen Werk stilistische Vielfalt und Innovation kennzeichnen. Bekannt wurde er zunächst durch seine bahnbrechenden Ballette "Der Feuervogel", "Petruschka" und besonders "Le sacre du printemps", die rhythmische Komplexität und klangliche Kühnheit zeigten.
📋 Arbeitsauftrag: Suche im Internet nach den folgenden Werken und schau dir diese aufmerksam an. Mache dir kurze Notizen zu den Werken:
- Ludwig Meidner – "Ich und die Stadt"
- Ernst Ludwig Kirchner – "Straße mit roter Kokotte"
Achte dabei vor allem auf folgende Aspekte: ungewohnte Darstellungsweisen, Dissonanzen, Fragmentierungen, intensive Farben etc.
✒️ Hier findest du Platz für deine Beobachtungen.
👥 Arbeitsauftrag Partnerarbeit: Tausche dich mit deinem Sitznachbarn / deiner Sitznachbarin über das Musikstück und die Bilder aus.
Beachtet dabei folgende Aspekte:
- Was fällt euch besonders auf?
- Welche Gefühle oder Stimmungen werden ausgelöst?
- Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Musik und Bild?
✒️ Hier findest du Platz für eure Beobachtungen.
Sammle die Eindrücke der Schüler:innen im Plenum.
Die pulsierende und zerrissene Moderne: Wahrnehmungen, Gefühle und Gemeinsamkeiten in Meidners, Kirchners und Strawinskys Werken
Betrachten wir Ludwig Meidners "Ich und die Stadt" (1913), Ernst Ludwig Kirchners "Straße mit roter Kokotte" (1914) und Igor Strawinskys Ballettmusik "Le Sacre du printemps" (Uraufführung 1913), so fallen unmittelbar intensive Eindrücke auf, die starke Gefühle und Stimmungen hervorrufen. Trotz ihrer unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen scheinen diese Werke auf einer tieferen Ebene miteinander zu resonieren und die Essenz einer Epoche einzufangen.
Was fällt auf?
In Meidners "Ich und die Stadt" sticht die eruptive, chaotische Darstellung der urbanen Szenerie ins Auge. Gebäude scheinen sich aufzulösen, Perspektiven kippen, und eine fiebrige Unruhe durchzieht das Bild. Die überhöhte, fast karikaturhafte Selbstinszenierung des Künstlers inmitten dieses Strudels verstärkt den Eindruck einer subjektiven, vielleicht sogar angstvollen Wahrnehmung der modernen Großstadt.
Kirchners "Straße mit roter Kokotte" präsentiert eine ebenso nervöse, aber stilistisch andersartige Interpretation des städtischen Lebens. Die spitzen, kantigen Formen der Figuren und Gebäude, die grellen, unnatürlichen Farben und die Enge des Bildraums erzeugen ein Gefühl von Disharmonie und latenter Bedrohung. Die Kokotte, als Symbol für die Schattenseiten der Großstadt, dominiert die Szene und trägt zur beunruhigenden Atmosphäre bei.
Strawinskys "Le Sacre du printemps" wiederum bricht mit traditionellen musikalischen Konventionen. Dissonante Akkorde, unregelmäßige Rhythmen und repetitive, fast archaische Motive erzeugen eine rohe, elementare Klangwelt. Die Musik evoziert Bilder von ritueller Wildheit, archaischer Kraft und einer losgelösten Energie, die jegliche Sanftheit vermissen lässt.
Welche Gefühle oder Stimmungen werden ausgelöst?
Die Werke rufen ähnliche emotionale Reaktionen hervor, wenn auch auf unterschiedliche Weise:
- Angst und Unbehagen: Meidners apokalyptische Stadtvision und Kirchners bedrohliche Straßenszene erzeugen ein Gefühl der Verunsicherung und potenziellen Gefahr. Auch Strawinskys Dissonanzen und abrupten Rhythmuswechsel können beim Hörer ein Gefühl des Unbehagens und der inneren Aufruhrs auslösen.
- Nervosität und innere Zerrissenheit: Die fragmentierten Formen und die dynamische Unruhe in den Gemälden spiegeln die Hektik und die psychische Belastung des modernen Lebens wider. In der Musik findet dies Entsprechung in den sprunghaften Rhythmen und den abrupten dynamischen Veränderungen.
- Faszination und Intensität: Trotz der beunruhigenden Aspekte üben die Werke eine starke Faszination aus. Die rohe Energie in Strawinskys Musik, die expressive Farbigkeit Kirchners und die visionäre Kraft Meidners ziehen den Betrachter oder Zuhörer in ihren Bann.
- Ein Gefühl des Umbruchs und des Neuen: Alle drei Werke brechen bewusst mit traditionellen Formen und Ausdrucksweisen. Sie vermitteln das Gefühl einer Zeit des radikalen Wandels, in der alte Sicherheiten verloren gehen und neue, aufwühlende Erfahrungen an ihre Stelle treten.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Musik und Bild?
Trotz der unterschiedlichen Medien lassen sich deutliche Gemeinsamkeiten zwischen den Werken erkennen:
- Der Ausdruck von Intensität und Unmittelbarkeit: Sowohl die expressiven Pinselstriche und die grellen Farben in den Gemälden als auch die rohe, ungeschliffene Klangsprache Strawinskys zielen auf eine direkte und unmittelbare Wirkung auf den Rezipienten ab.
- Die Auflösung traditioneller Formen: Meidner und Kirchner lösen die traditionelle Perspektive und naturalistische Darstellung auf, um ihre subjektiven Eindrücke zu vermitteln. Strawinsky bricht mit den Regeln der klassischen Harmonie und Rhythmik, um eine neue musikalische Sprache zu schaffen.
- Die Darstellung einer fragmentierten Realität: Die zersplitterten Formen in den Bildern und die unzusammenhängend wirkenden musikalischen Motive spiegeln ein Gefühl der Desorientierung und der Brüchigkeit der modernen Welt wider.
- Die Betonung des Subjektiven und Emotionalen: Alle drei Künstler scheinen weniger an einer objektiven Darstellung der Realität interessiert zu sein als vielmehr daran, ihre inneren Zustände und ihre emotionalen Reaktionen auf die moderne Welt auszudrücken.
- Die Antizipation des Umbruchs: Die Werke entstanden kurz vor dem Ersten Weltkrieg und können in ihrer Intensität und Zerrissenheit als Vorahnung der kommenden Katastrophe interpretiert werden. Sie fangen auf eindringliche Weise die latente Spannung und die unterschwellige Bedrohung der Zeit ein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Werke von Meidner, Kirchner und Strawinsky auf eindringliche Weise die Ambivalenz der Moderne widerspiegeln: die Faszination und den Schrecken des Fortschritts, die Hektik und die Entfremdung der Großstadt, die Suche nach neuen Ausdrucksformen in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels. Sie fordern den Betrachter und Zuhörer heraus, sich mit den Brüchen und der Intensität dieser Epoche auseinanderzusetzen und die emotionalen und psychischen Auswirkungen der Moderne zu spüren.
👥 Arbeitsauftrag Partnerarbeit: Stellt zusammen Hypothesen zu den folgenden Aspekten auf:
- Welche Rückschlüsse könnten diese Beispiele auf die Zeit zulassen, aus der sie stammen?
- Welche Themen könnten für die Künstlerinnen und Künstler wichtig gewesen sein?
- Welche Rolle spielt die Stadt in dieser Zeit?
✒️ Hier findest du Platz für eure Überlegungen.
Gemeinsame Besprechung in der Lerngruppe. Halte die zentralen Hypothesen an der Tafel oder einem digitalen Board fest.
📋 Arbeitsauftrag: Bearbeite den Lückentext, mit den vorgegebenen Begriffen.
Anschließende Besprechung im Plenum über die Ergebnisse.
👥 Arbeitsauftrag Partnerarbeit: Mach dir zusammen mit deinem Sitznachbarn / deiner Sitznachbarin Gedanken über die Themen in der Tabelle.
| Themen, welche die Künster:innen beschäftigt haben können | Wie wurde die Kunst/ Musik/ Literatur dargestellt? |
|---|---|
Mögliche Einträge für die Tabelle.
Themen: Stadt, Großstadtleben, Isolation, Entfremdung, Krieg, Tod, Ich-Zerfall, Aufbruch, Visionen.
Formale Gestaltung (Literatur): Fragmentierung, Reihungsstil, ungewöhnliche Metaphorik, Neologismen, Ausrufe, Ellipsen, freier Rhythmus.
Formale Gestaltung (Bildende Kunst): Intensive, oft unnatürliche Farben, verzerrte Perspektiven, kantige Formen, dynamische Linien, Reduktion auf das Wesentliche.
📋 Arbeitsauftrag: Lies den Text aufmerksam durch und beantworte anschließend die Fragen dazu.
Krieg und Verfall im Expressionismus
Der Expressionismus, eine Kunstbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, war stark von den gesellschaftlichen Umbrüchen und dem Ersten Weltkrieg geprägt. Diese Epoche ist bekannt für ihre intensive und manchmal verstörende Darstellung von Themen wie Krieg und Verfall. Expressionistische Künstler und Dichter zielten darauf ab, die tiefen Ängste und Unsicherheiten ihrer Zeit sichtbar zu machen.
Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Gedicht "Verfall" von Georg Trakl. Trakl beschreibt darin die melancholische Stimmung eines Herbstabends, der das Ende und den Verfall der Natur symbolisiert. In den ersten Strophen des Gedichts wird die Umgebung in einem positiven Licht dargestellt: Kirchenglocken läuten Frieden, und das lyrische Ich träumt von einer Reise mit Zugvögeln in wärmere Gefilde. Doch diese idyllische Vorstellung kippt abrupt, als das lyrische Ich aus seinem Traum erwacht und eine bedrohliche Realität wahrnimmt. Ein "Hauch von Verfall" und die "klagende Amsel" in den "entlaubten Zweigen" verdeutlichen die aufkommende Bedrohung und den Untergang. Trakl verwendet starke Symbole wie den "roten Wein" und die "blauen Astern", um die Vergänglichkeit und den unvermeidlichen Niedergang darzustellen. Diese Bilder drücken die Hoffnungslosigkeit und den Verlust aus, die im Expressionismus häufig thematisiert werden.
Ein weiteres bedeutendes Gedicht der Epoche ist "Die Irren" von Georg Heym. Heym beschreibt die Bewohner einer Irrenanstalt und nutzt sie als Metapher für den Wahnsinn und die Auflösung der Gesellschaft. Anfangs wirken die Irren wie gefangene Spinnen, die an den Gitterstäben ihrer Anstalt hängen. Doch plötzlich, in einer grotesken Wendung, tanzen sie ausgelassen und frei, bis der Wahnsinn sich in einem gewaltsamen Ausbruch manifestiert. Heym nutzt die Figur des Irren, um die gesellschaftlichen Zwänge und die Kälte der wilhelminischen Vorkriegsgesellschaft zu kritisieren. Der Mord an einem Arzt symbolisiert die Ablehnung der bürgerlichen Vernunft und die Verzweiflung über die Unmöglichkeit einer echten Veränderung. Diese Darstellung zeigt die Hoffnungslosigkeit und das Gefühl der Ohnmacht, das viele Menschen in dieser Zeit empfanden.
Der Expressionismus war eine Antwort auf die Schrecken des Krieges und den Verfall der Gesellschaft. Durch die Verwendung von eindringlichen Bildern und Metaphern schufen Dichter wie Trakl und Heym Werke, die die emotionalen und psychologischen Auswirkungen dieser turbulenten Zeit einfangen. Ihre Gedichte sind Ausdruck der Suche nach Sinn und Menschlichkeit in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Der Krieg und der Verfall bleiben zentrale Themen, die die expressionistische Literatur prägen und bis heute ihre Kraft und Bedeutung bewahren.
Kreuze die richtige Antwort an.
✒️ Hier findest du Platz für Themen, die im anschließenden Gespräch festgehalten werden.
Greife auf die Hypothesen zurück, die bei einer Aufgabe festgehalten wurden. Eröffne zum Abschluss der Stunde ein erneutes Gespräch in der Lerngruppe, sodass die Schüler:innen gemeinsam die Hypothesen ergänzen oder überarbeiten können.