
Wissenschaftliches Arbeiten: Erste Schritte
Zielsetzung: Die Schüler:innen erarbeiten grundlegende Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens: von der Themen- und Fragestellung über Literaturrecherche bis hin zu formalen Zitierregeln und Schreibprozessen.
Inhalte und Methoden: Das Arbeitsblatt enthält eine persönliche Einstiegssequenz, Zuordnungsübungen zu wichtigen Fachbegriffen (These, Fragestellung, Gliederung etc.), einen exemplarischen Phasenplan für das Verfassen einer Facharbeit, praxisorientierte Anleitungen zur Themenfindung, systematische Recherchemethoden (Datenbanken, Schneeballprinzip), Checklisten für korrekte Literaturangaben, Informationen und Übungen zum Paraphrasieren sowie Quiz- und Feedbackelemente zur Selbstüberprüfung.
Kompetenzen:
- Präzise Formulierung von Forschungsfragen
- Einordnung und Anwendung zentraler Fachbegriffe
- Planung und Strukturierung von Arbeitsschritten
- Gezielte Literaturrecherche und Quellenbewertung
- Einhaltung wissenschaftlicher Zitierstandards
- Sinnvolle Paraphrasierung und Vermeidung von Plagiaten
- Selbst- und Peer-Feedback für die Textüberarbeitung
Hinweis: Dieses Arbeitsblatt eignet sich auch für eine Stationenarbeit mit verschiedenen Schwerpunkten (Einführung - Fragestellung - Literaturangaben - Paraphrasierung)
81 other teachers use this template
Target group and level
Ab Klasse 10
Subjects
Wissenschaftliches Arbeiten: Erste Schritte

Nachricht an dich
Hallo!
Ich bin Kian und gehe in die 12. Klasse. Ich muss meine Facharbeit schreiben und ehrlich gesagt bin ich etwas überfordert. Mein Thema ist Artenschutz, und ich finde das super wichtig. Es ist krass, wie viele Arten jedes Jahr aussterben und wie das unsere Umwelt trifft. Ich will rausfinden, wie wir mehr tun können, um das zu stoppen, und wie sich das auf uns alle auswirkt, vor allem mit dem Klimawandel, der alles noch schlimmer macht. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich das Thema angehen kann? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und könnte echt ein bisschen Hilfe gebrauchen.
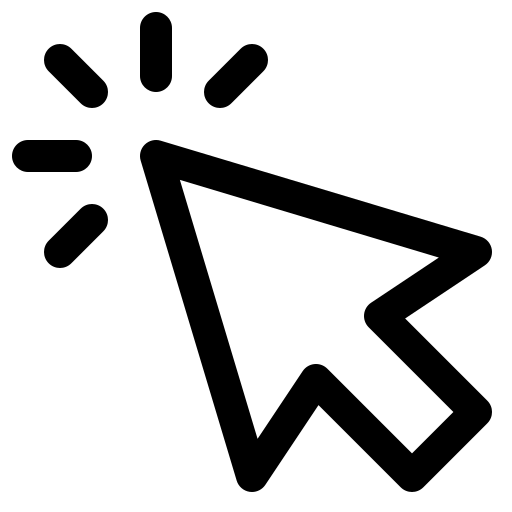
Wie hieß das noch mal?
Uff... So viele neue Wörter und Begriffe. Ich versteh' nur Bahnhof. Kannst du diese wieder richtig für mich ordnen?
Ordne die Fachbegriffe den richtigen Definitionen zu.
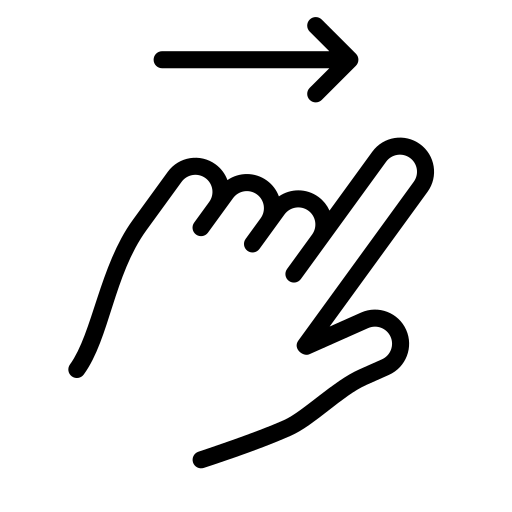
Wie gehe ich jetzt vor?
Ich hab den Ablauf von so einer wissenschaftlichen Arbeit im Internet recherchiert und hier aufgeschrieben. Dann hab ich eine falsche Taste gedrückt und jetzt ist auch hier alles durcheinander🫠🙄 Vielleicht hast du eine Idee, wie so ein typischer Ablauf aussehen könnte? Ich denke, es beginnt mit der Orientierung, oder was meinst du?
Bringe die Arbeitsphasen bei wissenschaftlichen Projekten in die richtige Reihenfolge. Wie würdest du vorgehen?
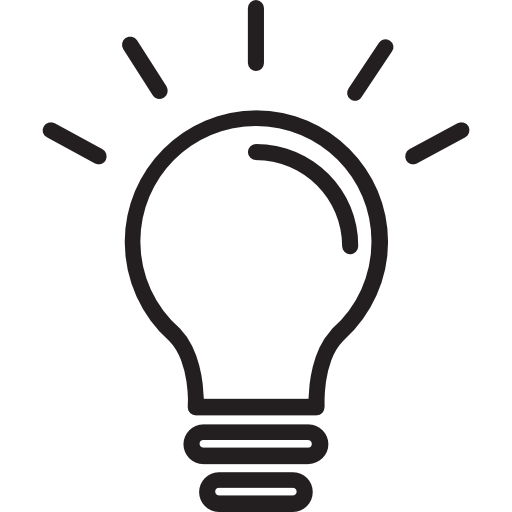
Von der Idee zur Fragestellung
Die Forschungsfrage ist der Kern deiner Arbeit. Sie macht aus einem breiten Thema eine präzise Aufgabe, die du mithilfe von Fakten und Methoden beantworten willst — kein „Referat über alles“, sondern eine klar umrissene Frage.
So kommst du von der Idee zur Frage
- Thema eingrenzen: „Frühkindliche Entwicklung“ → Welche Rolle spielen Smartphones?
- Problem erkennen: Gibt es hier einen offenen Streitpunkt oder ein ungeklärtes Phänomen?
- Offen fragen: Formuliere eine W-Frage („Wie“, „Warum“, „Inwiefern“ …), keine Ja/Nein-Frage.
- Kurz fassen: Die Frage sollte in 1-2 Sätzen stehen; sonst ist sie noch zu schwammig
Checkliste - Erfüllt deine Frage diese Kriterien?
- Machbar: Recherchierbar mit Büchern, Daten, Zeit.
- Offen & logisch: Lässt Raum für Argumente und Beweise; keine reine Faktenaufzählung.
- Problembasiert & kontrovers: Führt zu Diskussion, nicht nur zu einer Liste.
- Neutral formuliert: Vermeide wertende Wörter wie „attraktiv“.
- Präzise: Klarer Zeit-, Orts- oder Personenzuschnitt („Berlin und Paris 2024“ statt „in Europa“).
- Persönlicher Bezug: Du findest das Thema spannend — dann bleibst du dran!
Beispiel für eine gelungene Frage
„Syrien unter französischer Verwaltung 1919-1939 – Mandatsgebiet oder Kolonie?“
✔ klar umrissener Zeit- und Ortsrahmen
✔ kontrovers: zwei mögliche Antworten
✔ ermöglicht Argumentation
Typische Stolpersteine
- Zu breit: „Alles über erneuerbare Energien“.
- Reine Beschreibung: „Vergleich des deutschen und englischen Schulsystems“
- Kein Erkenntnisinteresse: einfache Ja/Nein-Fragen („Sind E-Autos beliebt?“).
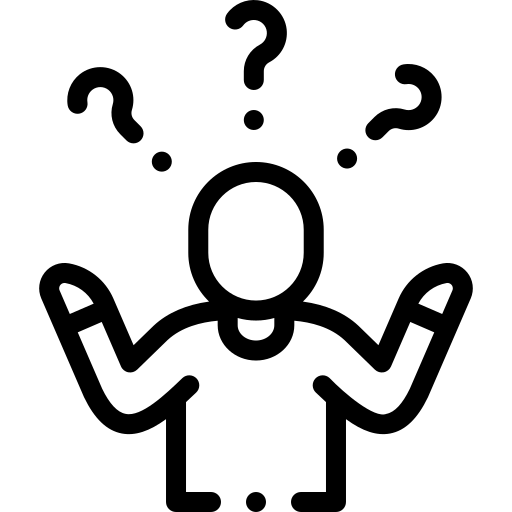
Sind die Fragen in Ordnung?
Vielen Dank für deine bisherige Hilfe. Ich habe mir nun Gedanken über mögliche Fragestellungen gemacht. Kannst du mir helfen und sagen, welche Fragestellungen passen und welche eher nicht? Und wieso?
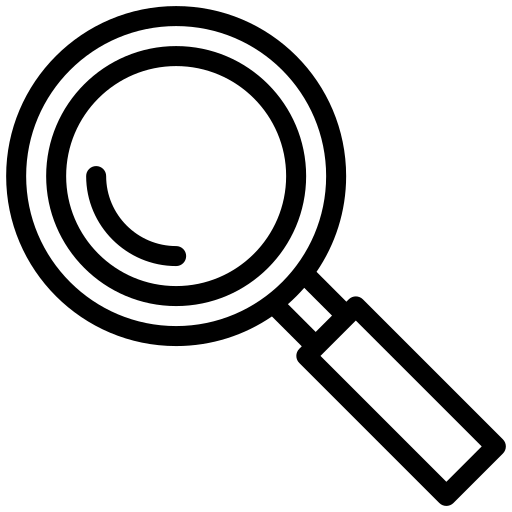
Wissenschaftliche Literatur finden - Schnelle Starthilfe!
1 | Thema in Suchbegriffe übersetzen
- Schreibe 3-5 Stichwörter auf, die dein Thema repräsentieren (Fachbegriffe, Synonyme).
- Beispiel: „Smartphones“ + „frühkindliche Entwicklung“ + „kognitive Folgen“.
2 | Erste Orientierung holen
- Gib dein Thema und deine Stichwörter in eine Internet-Suchmaschine ein.
- Wikipedia & Blogs nur zum Überblick nutzen, nicht zitieren
- Achte dort auf die Literaturlisten unten - sie sind dein Sprungbrett zu echten Quellen.
3 | Gezielt suchen
Wo & Was es bringt
Schul-/Stadt- oder Uni-Katalog (OPAC): Bücher & E-Books (Monographien, Sammelbände)
Fachdatenbanken (z. B. Primus HU-Berlin, KVK, DNB): Schnelle Titel-Übersicht, Filter nach Jahr, Sprache
Google Scholar / Google Books: Freie PDFs, Kapitelvorschau; Zitatfunktion
Fachzeitschriften / Journals: Aktuelle Studien, Peer Review
Tipp: Suche erst weit („Frühkindliche Entwicklung“), dann eng („Smartphone-Nutzung 2-bis-4-Jährige Deutschland 2023“).
4 | Schneeball-Trick anwenden
- In jedem passenden Text das Literaturverzeichnis durchgehen.
- Relevante Titel ankreuzen --> wieder suchen --> so wächst deine Sammlung fast von selbst.
5 | Quelle prüfen – die 5-Sekunden-Checks
- Autor:in bekannt? Uni, Institut, Fachzeitschrift = gut.
- Aktuell? Je nach Fach ideal ≤ 5 Jahre.
- Quellenangaben drin? Fußnoten, Referenzen?
- Peer-reviewt oder Verlag? Blog-Posts zählen nicht.
- Passt wirklich zum Thema? Kurz Inhaltsverzeichnis / Abstract lesen.
6 | Alles sofort notieren
- Vollständige Literaturangabe plus Seitenzahl (spart später Sucherei).
- Markiere beim Lesen Beispiele (!) und Definitionen (D) am Rand – du findest sie schneller wieder.
7 | Falls du feststeckst …
- Schlagwort anpassen (englische Begriffe, Ober-/Unterthemen).
- In Bibliotheks-Chat oder bei der Lehrkraft nach passender Datenbank fragen.
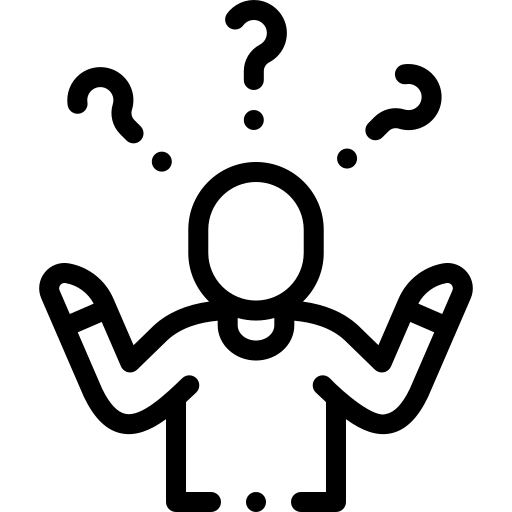
Richtig verstanden?
Hab ich alles richtig verstanden zum Thema Literaturrecherche?
Wahr oder falsch?
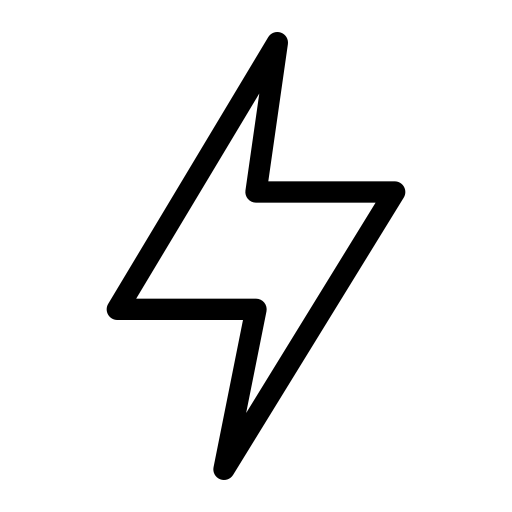
Blitz-Guide: Literaturangaben
1 | Warum überhaupt?
Literaturangaben zeigen, woher deine Infos stammen. Ohne sie gilt jede fremde Idee als geklaut --> Plagiat!
2 | Zwei Orte für Quellen
- Kurzverweis im Text: (vgl. Müller 2007: 15)
- Literaturverzeichnis: Vollständige Daten, alphabetisch sortiert: Müller, Hans (2007): Lernen digital. 2. Aufl. Berlin: Springer.
Grundregel: Entscheide dich einmal für ein (Literatur-/Zitier-)Format (z.B. APA) und zieh es in der ganzen Arbeit konsequent durch!
3 | Grundbausteine je Medientyp (hier nach Harvard)
Monographie Name, Vorname (Jahr): Titel, Untertitel, Auflage, Ort: Verlag.
Zeitschrift Name, Vorname (Jahr): Titel, Untertitel, in: Titel der Zeitschrift, Bandnummer, Heftnummer, Seitenzahlen.
Sammelband Name, Vorname (Jahr): Titel, Untertitel, in: Name des Herausgebers (Hrsg.), Titel des Sammelbandes, ggf. Band, ggf. Auflage, Ort: Verlag, Seitenzahlen.
Internetseite Name, Vorname (Jahr): Titel. Abgerufen am… Verfügbar unter: URL
Beispiele
• Leonhard, Hans-Walter (1992): Pädagogik studieren. Stuttgart: Kohlhammer.
• Rockefeller, David (2000): Die Skylines der Quellenangaben, in: John F. Kennedy (Hrsg.), Manhattan Citations, 2. Bd., 2. Aufl., New York: Präsident Verlag, S. 56–112.
• Mustermann, Max (2019): Zitieren nach der Harvard Zitierweise, in: Zeitschrift für wissenschaftliches Arbeiten, 2. Bd., 5, S. 12-22.
• Kratzer, Dietmar (2011): Die wichtigsten Richtlinien für Quellenangaben nach den Richtlinien der DGPs bzw. APA. Abgerufen am 18.10.2011. Verfügbar unter: http://www.uibk.ac.at/psychologie/mitarbeiter/kratzer/docs/die-wichtigsten-quellenangaben-nach-dgpsu-apa-2011.pdf
4 | Schnell-Check vor Abgabe
- Vollständig? Alles Nötige enthalten (Autor, Jahr, Titel …).
- Einheitlich? Gleiche Satzzeichen, Kursivsetzung, Abkürzungen.
- Abgleich Text ↔ Liste: Jeder Kurzverweis muss unten auftauchen – und umgekehrt.
5 | Tipp
Schreibe jede Quelle sofort sauber auf – spart Stunden am Ende!
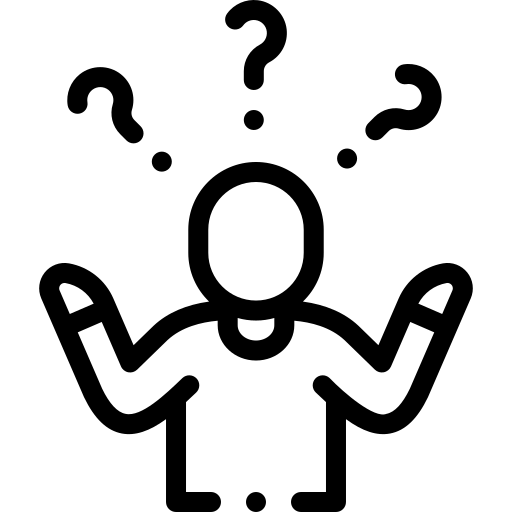
Literaturangaben
Ich habe nun einige Literaturquellen gefunden und auch notiert. Kannst du überprüfen, ob ich diese richtig und ordentlich notiert habe?
Sind die Literaturangaben vollständig?
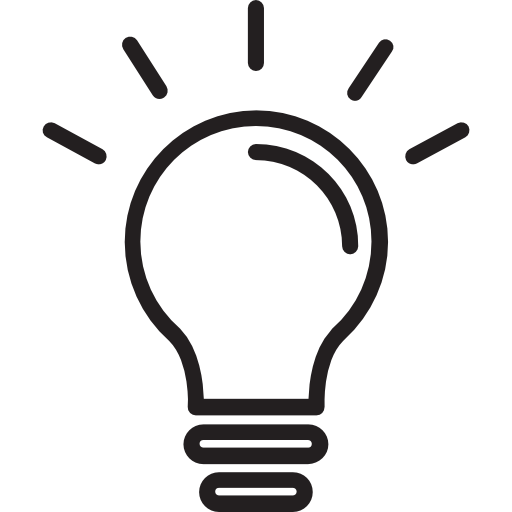
Paraphrasieren = Indirektes Zitat
Ich soll Inhalte, die passend sind, paraphrasieren - also umschreiben. Ich habe hier mal eine Quelle rausgesucht. Ein indirektes Zitat ist also eine sinngemäße Wiedergabe der Information/Argumentation eines Textes, bei dem die genaue Wortwahl nicht wichtig ist.
Wie erstelle ich eine Paraphrase?
- Sinngemäße Umschreibung der Kernaussage mit eigenen Worten
- keine Anführungszeichen
- i. d. R. kürzer als Zitat
- Beleg mit vgl. = vergleiche (vgl. Autor:inname 2023, S. 15)
Artenschutz: Eine kritische Herausforderung unserer Zeit (KI-generiert)
Autor: OpenAI 2023
Der Artenschutz ist ein zentrales Thema im Naturschutz, das sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene große Aufmerksamkeit erfordert. In einer Zeit, in der die Biodiversität weltweit bedroht ist, gewinnt der Schutz bedrohter Arten zunehmend an Bedeutung. Doch was bedeutet Artenschutz eigentlich, und wie wird er umgesetzt?
Artenschutz umfasst den Schutz und die Pflege bestimmter wildlebender Arten, sei es aus ethischen oder ökologischen Gründen. Während der Tierschutz sich auf das individuelle Wohl von Tieren konzentriert, zielt der Artenschutz auf die Erhaltung lebensfähiger Populationen. Dies bedeutet, dass der Tod einzelner Individuen tolerierbar ist, solange die Gesamtpopulation nicht gefährdet ist. Eine zentrale Rolle spielen dabei nationale und internationale Artenschutzgesetze sowie Programme, die sich auf einzelne gefährdete Arten konzentrieren.
In Deutschland regelt das Bundesnaturschutzgesetz den Artenschutz. Es sieht zwei Schutzstufen vor: besonders geschützte und streng geschützte Arten. Die Rechtsgrundlage für diesen Schutz beruht auf internationalen Abkommen wie dem Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) und der FFH-Richtlinie der Europäischen Union. Diese Abkommen verpflichten die Mitgliedstaaten zur Erhaltung der Artenvielfalt und zum Schutz gefährdeter Arten.
Weltweit betreibt der World Wide Fund For Nature (WWF) über 1.300 Artenschutzprojekte, die intakte Lebensräume und wildlebende Tier- und Pflanzenarten bewahren sollen. Der WWF setzt sich für die Ausweisung neuer Schutzgebiete ein und unterstützt die Verwaltung bestehender Gebiete. Er fördert die Vernetzung von Lebensräumen und die Ausbildung von Rangern, um gegen Bedrohungen wie Wilderei vorzugehen. Die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungen ist dabei entscheidend, denn nur gemeinsam kann ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Natur gewährleistet werden.
Artenschutz bedeutet jedoch nicht nur den Erhalt von Lebensräumen und das Aufrechterhalten gesunder Ökosysteme. Er umfasst auch Wiederansiedelungsprogramme und die medizinische Versorgung von Wildtieren. Politische Arbeit und Forschung spielen eine wichtige Rolle, um den Zustand der globalen Artenvielfalt zu überwachen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Besonders wichtig ist es, die Menschen vor Ort in die Schutzmaßnahmen einzubeziehen. Indigene Gemeinschaften und lokale Bewohner sind oft die besten Hüter ihrer Umwelt. Ihre Einbindung in den Artenschutzprozess ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahmen. So wird nicht nur die Natur geschützt, sondern auch die Lebensgrundlage der Menschen gesichert.
In Zeiten des Artensterbens, das sich dramatisch beschleunigt, ist der Artenschutz eine Herausforderung, die politisches Engagement, gesellschaftliche Unterstützung und individuelle Verantwortung erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann der Verlust der Artenvielfalt gestoppt und eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen gesichert werden.
Quellen
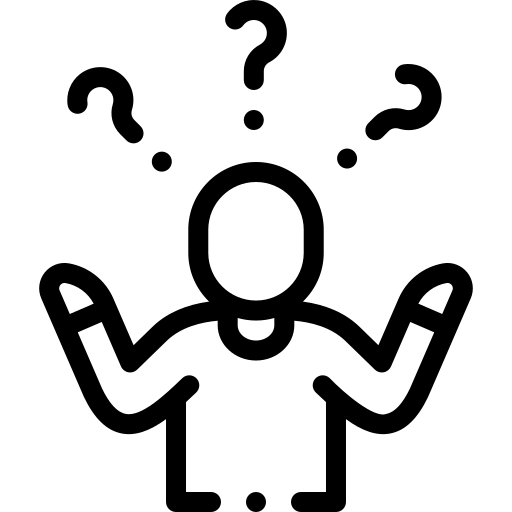
Zitate paraphrasieren
Ich habe hier mal ein paar passende und interessante Zitate rausgesucht. Könntest du diese im Text suchen und paraphrasieren? Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden hab. Danke!
| Direktes Zitat | Paraphrasierung |
|---|---|
| "Artenschutz umfasst den Schutz und die Pflege bestimmter wildlebender Arten, sei es aus ethischen oder ökologischen Gründen. Während der Tierschutz sich auf das individuelle Wohl von Tieren konzentriert, zielt der Artenschutz auf die Erhaltung lebensfähiger Populationen. Dies bedeutet, dass der Tod einzelner Individuen tolerierbar ist, solange die Gesamtpopulation nicht gefährdet ist. Eine zentrale Rolle spielen dabei nationale und internationale Artenschutzgesetze sowie Programme, die sich auf einzelne gefährdete Arten konzentrieren." | |
| "In Deutschland regelt das Bundesnaturschutzgesetz den Artenschutz. Es sieht zwei Schutzstufen vor: besonders geschützte und streng geschützte Arten. Die Rechtsgrundlage für diesen Schutz beruht auf internationalen Abkommen wie dem Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) und der FFH-Richtlinie der Europäischen Union. Diese Abkommen verpflichten die Mitgliedstaaten zur Erhaltung der Artenvielfalt und zum Schutz gefährdeter Arten." | |
| "Weltweit betreibt der World Wide Fund For Nature (WWF) über 1.300 Artenschutzprojekte, die intakte Lebensräume und wildlebende Tier- und Pflanzenarten bewahren sollen. Der WWF setzt sich für die Ausweisung neuer Schutzgebiete ein und unterstützt die Verwaltung bestehender Gebiete. Er fördert die Vernetzung von Lebensräumen und die Ausbildung von Rangern, um gegen Bedrohungen wie Wilderei vorzugehen." |
| Direktes Zitat | Paraphrasierung |
|---|---|
| "Artenschutz umfasst den Schutz und die Pflege bestimmter wildlebender Arten, sei es aus ethischen oder ökologischen Gründen. Während der Tierschutz sich auf das individuelle Wohl von Tieren konzentriert, zielt der Artenschutz auf die Erhaltung lebensfähiger Populationen. Dies bedeutet, dass der Tod einzelner Individuen tolerierbar ist, solange die Gesamtpopulation nicht gefährdet ist. Eine zentrale Rolle spielen dabei nationale und internationale Artenschutzgesetze sowie Programme, die sich auf einzelne gefährdete Arten konzentrieren." | Artenschutz fokussiert sich auf den Erhalt ganzer Artenpopulationen und stützt sich dabei auf nationale sowie internationale Gesetze. (vgl. OpenAI 2023) |
| "In Deutschland regelt das Bundesnaturschutzgesetz den Artenschutz. Es sieht zwei Schutzstufen vor: besonders geschützte und streng geschützte Arten. Die Rechtsgrundlage für diesen Schutz beruht auf internationalen Abkommen wie dem Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) und der FFH-Richtlinie der Europäischen Union. Diese Abkommen verpflichten die Mitgliedstaaten zur Erhaltung der Artenvielfalt und zum Schutz gefährdeter Arten." | Das Bundesnaturschutzgesetz in Deutschland unterscheidet Arten in zwei Schutzklassen und basiert auf internationalen Abkommen zum Erhalt der Artenvielfalt. (vgl. OpenAI 2023) |
| "Weltweit betreibt der World Wide Fund For Nature (WWF) über 1.300 Artenschutzprojekte, die intakte Lebensräume und wildlebende Tier- und Pflanzenarten bewahren sollen. Der WWF setzt sich für die Ausweisung neuer Schutzgebiete ein und unterstützt die Verwaltung bestehender Gebiete. Er fördert die Vernetzung von Lebensräumen und die Ausbildung von Rangern, um gegen Bedrohungen wie Wilderei vorzugehen." | Der WWF führt weltweit zahlreiche Projekte durch, um Lebensräume zu schützen und Wildtiere zu bewahren, unter anderem durch die Einrichtung und Verwaltung von Schutzgebieten. (vgl. OpenAI 2023) |
