
Instrumente der Fiskalpolitik
Zielsetzung:
Die Lernenden verstehen die Grundlagen der Fiskalpolitik, ihre Instrumente und deren Anwendung zur Beeinflussung der Wirtschaft und zur Reaktion auf Krisen.
Inhalte und Methoden:
Das Arbeitsblatt führt in die Fiskalpolitik ein, definiert sie und erklärt ihre antizyklische Funktion. Es behandelt expansive und restriktive Fiskalpolitik anhand von Staatsausgaben und Steuern als zentrale Hebel. Ein spezieller Fokus liegt auf einem ausgewählten fiskalpolitischen Instrument. Die Lernenden sehen ein Einführungsvideo, bearbeiten Lückentexte, begründen Entscheidungen zu fiskalpolitischen Maßnahmen in verschiedenen Wirtschaftsszenarien und lernen ein konkretes Instrument genauer kennen.
Kompetenzen:
- Analyse von wirtschaftspolitischen Situationen und Ableitung geeigneter fiskalpolitischer Maßnahmen
- Verständnis der Zusammenhänge zwischen Staatsausgaben, Steuern und gesamtwirtschaftlicher Nachfrage
- Erkennen von Vorteilen und Herausforderungen fiskalpolitischer Instrumente
- Erläuterung komplexer wirtschaftlicher Konzepte in eigenen Worten
Zielgruppe und Niveau:
ab Klasse 11
58 other teachers use this template
Target group and level
ab Klasse 11
Subjects
Instrumente der Fiskalpolitik
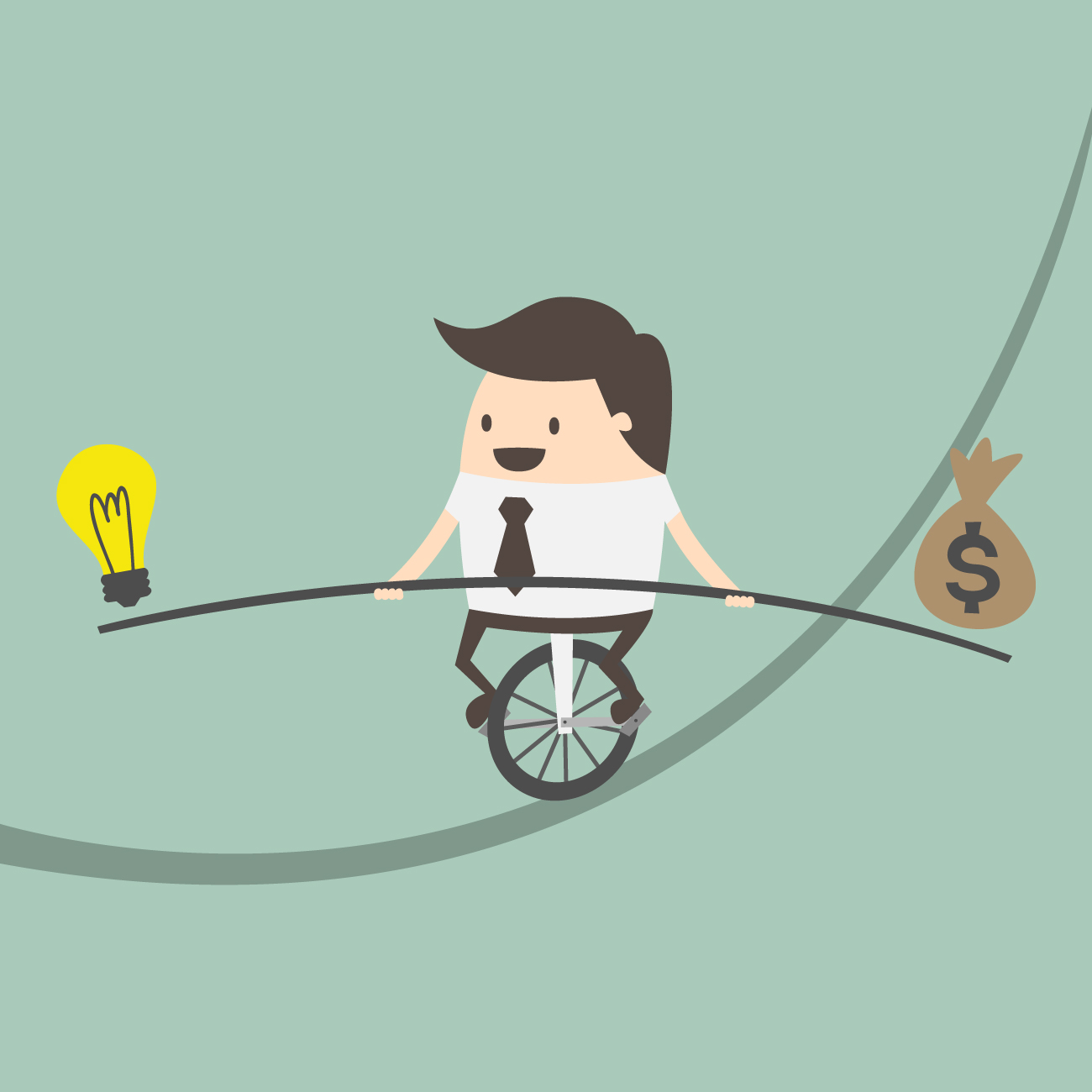

Einleitung
Heute geht es um die Fiskalpolitik.
Das ist wichtig, weil der Staat mit bestimmten Maßnahmen die Wirtschaft beeinflussen und auf Krisen reagieren kann. Du lernst, welche Instrumente dabei eine Rolle spielen.
🎬 Schaue dir zuerst das Video an und fülle anschließend den Lückentext aus.
📝Trage die richtigen Begriffe in die Lücken ein.
📝 Welche konkreten Maßnahmen könnte der Staat für eine Erhöhung oder eine Senkung der Staatsausgaben oder Steuern ergreifen? Notiere deine Ideen.
📌 Grundsätzlich wirken alle fiskalpolitischen Instrumente über die zwei großen Hebel, die du bereits kennst: Staatsausgaben und Steuern.
Expansive Fiskalpolitik
Hier geht es darum, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu erhöhen, um die Wirtschaft aus einer Krise zu holen oder einen Abschwung zu mildern. Dies führt tendenziell zu einer Zunahme des Haushaltsdefizits bzw. einer Schuldenaufnahme. Dafür werden die Staatsausgaben erhöht und die Steuern gesenkt.
Restriktive Fiskalpolitik
Hier geht es darum, eine Überhitzung der Wirtschaft (mit Risiken wie Inflation) zu verhindern oder abzubauen. Dies führt tendenziell zu einem Abbau von Staatsschulden oder zur Bildung von Rücklagen. Dafür werden die Staatsaufgaben gesenkt oder die Steuern erhöht.
Investition in Infrastruktur als fiskalpolitisches Instrument
Die Investition in Infrastruktur ist ein bedeutendes fiskalpolitisches Instrument, das von Staaten genutzt wird, um die wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln und langfristiges Wachstum zu fördern. Unter Infrastruktur versteht man die grundlegenden Einrichtungen und Systeme, die für das Funktionieren einer Wirtschaft notwendig sind, wie Straßen, Brücken, öffentliche Verkehrsmittel, Energieversorgung und digitale Netze. Die Investition in diese Bereiche verbessert nicht nur die Effizienz und Produktivität einer Volkswirtschaft, sondern schafft auch Arbeitsplätze und kann das allgemeine Wohlstandsniveau heben.
Der primäre Wirkungsmechanismus dieses Instruments liegt im sogenannten Multiplikatoreffekt. Wenn der Staat in Infrastrukturprojekte investiert, werden direkte Arbeitsplätze geschaffen, sowohl in der Bauwirtschaft als auch in verwandten Sektoren. Die Beschäftigten, die durch diese Projekte ein Einkommen erzielen, geben einen Teil ihres Einkommens aus, was wiederum die Nachfrage in anderen Teilen der Wirtschaft erhöht. Diese erhöhte Nachfrage kann weitere Arbeitsplätze schaffen und so einen positiven Kreislauf des Wirtschaftswachstums initiieren. Über die Zeit verbessert die verbesserte Infrastruktur die Produktivität der gesamten Wirtschaft, da Güter und Dienstleistungen effizienter produziert und verteilt werden können.
Typischerweise handelt es sich bei Investitionen in Infrastruktur um eine expansive fiskalpolitische Maßnahme. Sie wird vorrangig in Zeiten wirtschaftlicher Rezession oder schwachen Wachstums eingesetzt, um die Konjunktur zu beleben und das Vertrauen der Bürger:innen sowie der Unternehmen in die wirtschaftliche Zukunft zu stärken. Indem der Staat aktiv in die Wirtschaft investiert, kann er private Investitionen stimulieren und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigern.
Ein reales Beispiel für den Einsatz dieses Instruments ist die Reaktion Deutschlands auf die Corona-Krise. Im Rahmen des Konjunkturpakets 2020 investierte die Bundesregierung erheblich in die digitale Infrastruktur und den Ausbau erneuerbarer Energien. Diese Maßnahmen wurden in Kombination mit anderen fiskalpolitischen Instrumenten, wie direkten Finanzhilfen für Unternehmen und einem temporären ermäßigten Mehrwertsteuersatz, umgesetzt. Ziel war es, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu mildern und gleichzeitig den Übergang zu einer nachhaltigeren und digitalisierten Wirtschaft zu fördern.
Die positiven Folgen dieser Strategie waren unter anderem eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes und eine Stimulation der Digitalisierung, die langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands verbessern kann. Allerdings gibt es auch negative Aspekte zu berücksichtigen. Die hohe Staatsverschuldung, die durch solche expansiven Maßnahmen entsteht, könnte langfristig zu einer Belastung der öffentlichen Finanzen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass ineffiziente Projekte umgesetzt werden, die nicht den gewünschten wirtschaftlichen Nutzen bringen. Dennoch hat die Investition in Infrastruktur während der Corona-Krise gezeigt, wie wichtig staatliche Maßnahmen sein können, um in Krisenzeiten die wirtschaftliche Resilienz zu stärken und die Basis für zukünftiges Wachstum zu legen.