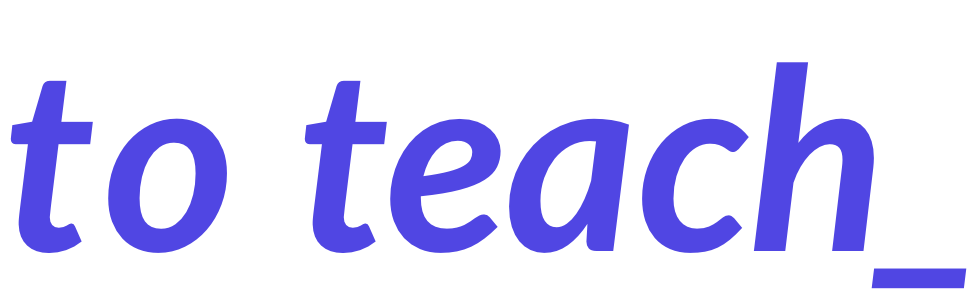Diskriminierungssensibler Unterricht: Privilegien & Diskriminierung (Grundschule)

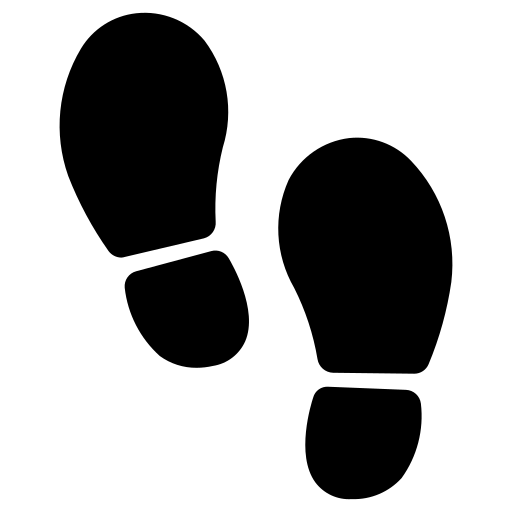
Das Privilegien-Wettrennen
Diese Übung kannst du alleine oder mit einer Gruppe machen. Leg dir ein Blatt zurecht (am besten mit Kästchen) und zeichne einen Anfangspunkt ein. Ziehe eine Rollenkarte. Versetze dich in deine Rolle und stelle dir hierfür folgende Fragen:
- Wie lebst du?
- Verdienst du eher viel oder wenig Geld?
- Kennst du viele Menschen, die so sind wie du?
- Wo erlebst du regelmäßig Einschränkungen oder sogar Ausgrenzung?
- Wie sieht dein soziales Umfeld sonst so aus?
Höre nun die Statements. Wenn du (in deiner Rolle) die Aussagen oder Fragen mit "Ja" beantworten würdest, gehe jedes Mal einen Schritt (z. B. ein Kästchen) mit deiner Rolle vor (z. B. mit einer Münze oder etwas anderem). Wenn nicht oder neutral, bleibst du stehen. Mache ein Kreuzchen auf der letzten Position deiner Rolle.
Wiederhole die Übung mit einer anderen Rolle.
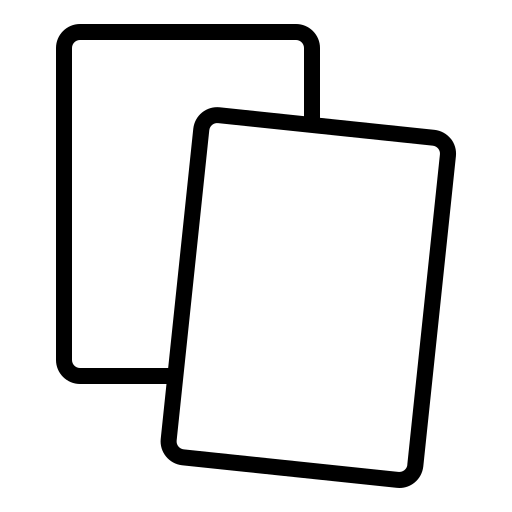
Rollenkarten
| Du bist eine 26-jährige alleinerziehende Mutter, weiß-deutsch, keine Religion |
| Du bist eine 16-jährige geflüchtete Person aus Syrien, die in einem Geflüchtetenlager untergebracht ist, muslimisch |
| Du bist eine 20-jährige geflüchtete Person aus dem Kongo, ausländischer Schulabschluss, christlich |
| Du bist ein 19-jähriger Abiturient mit deutschem Pass, Eltern türkischer Herkunft, keine Religion |
| Du bist 17 Jahre alt, männlich, weiß, farbenblind und in einer handwerklichen Ausbildung. |
| Du bist 12 Jahre alt, männlich, weiß-deutsch, katholisch, und hast eine Sehbehinderung. |
| Du bist 10 Jahre alt, weiblich, Schwarz, muslimisch. |
| Du bist 13 Jahre alt, weiblich, weiß, benutzt einen Rollstuhl. |
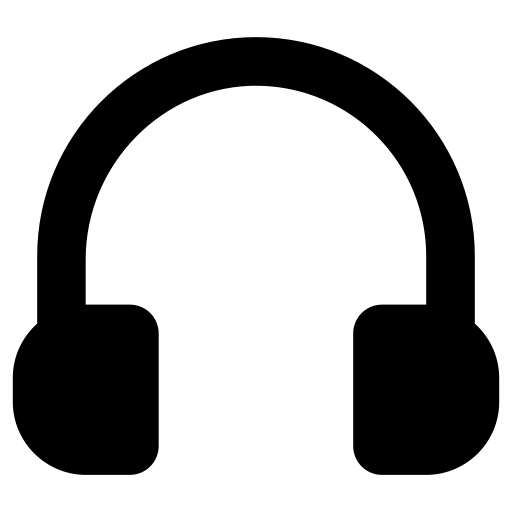
Statements zum Anhören
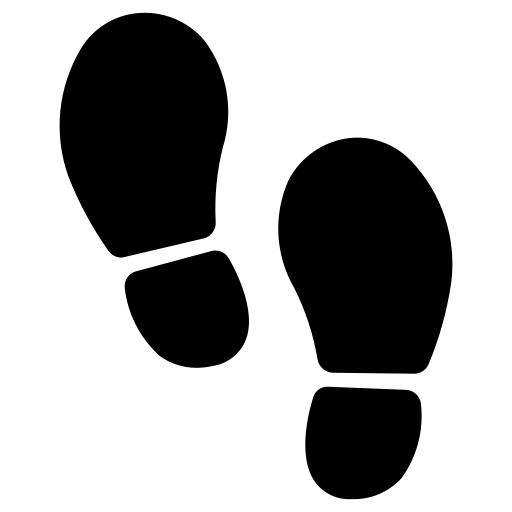
Das Wettrennen
Stell dir nun vor, es findet ein Wettrennen statt. Verschiedene Läufer und Läuferinnen starten von unterschiedlichen Positionen oder mit deutlichem zeitlichen Vorsprung. Das sind die Endpositionen der Rollenkarten der Übung zuvor. Schaue dir die Positionen an.
Überlege und diskutiere mit deiner Klasse oder mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn:
- Wer gewinnt das Rennen?
- Für wen ist das Rennen leichter?
- Für wen ist es schwerer?
- Wie würde ein gerechter Wettlauf aussehen?
Unsere Welt oder Gesellschaft kann man mit einem solchen Rennen vergleichen. Denn auch in unserem Alltag haben nicht alle Menschen die gleichen Startpositionen. Manche haben es leichter, manche haben es schwerer.
Diejenigen, die es leichter haben, haben bestimmte Privilegien oder Vorteile, die andere nicht besitzen. Andere haben diese Vorteile nicht und haben es dadurch schwerer im Leben. Sie sind anders und werden ungerecht behandelt - Das nennt man Diskriminierung.
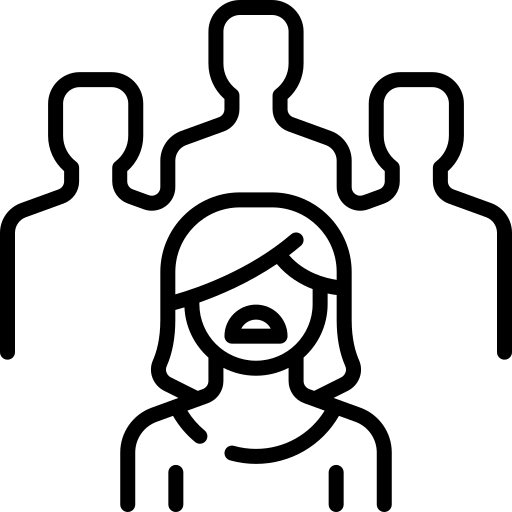
Diskriminierung
Doch wie kann sich Diskriminierung zeigen? Lerne zwei Formen kennen, indem du die Definitionen liest (oder hörst) und die Aufgaben löst.
Ableismus - Was bedeutet das?
Ableismus ist ein schwieriges Wort, aber es bedeutet ganz einfach, dass Menschen mit einer Behinderung ungerecht behandelt werden. Stell dir vor, du hast einen Freund, der im Rollstuhl sitzt. Wenn du ihm ständig ungefragt über die Straße hilfst, obwohl er das gar nicht will, dann ist das ein Beispiel für Ableismus. Es ist wichtig, Menschen mit Behinderung zu fragen, was sie brauchen und sie nicht automatisch anders zu behandeln.
Ein weiteres Beispiel ist, wenn ein Kind mit Lernschwierigkeiten nicht an den gleichen Schulaktivitäten teilnehmen darf wie die anderen Kinder, nur weil es länger braucht, um zu lernen. Das ist unfair und nennt sich Ableismus.
Wir sollten alle darauf achten, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt wird. Jeder Mensch ist gleich wertvoll und sollte die gleichen Chancen haben.
Quelle: kindersache.de
Wahr oder falsch?
Was bedeutet Rassismus?
Rassismus ist, wenn Menschen zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion benachteiligt oder schlecht behandelt werden. Zum Beispiel könnte jemand nicht mitspielen dürfen, weil er eine andere Hautfarbe hat. Oder jemand wird in der Schule geärgert, weil er aus einem anderen Land kommt.
Beispiele: Ein Kind aus einem anderen Land wird ausgelacht, weil es anders spricht. Oder ein Mitschüler mit dunkler Hautfarbe wird nicht zum Geburtstag eingeladen.
Quelle: ZDF logo!
Wähle die richtige Antwort.
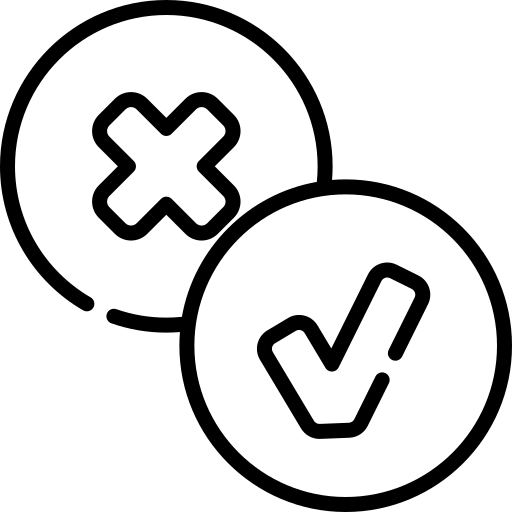
Abschluss
Prüfe dein Wissen.