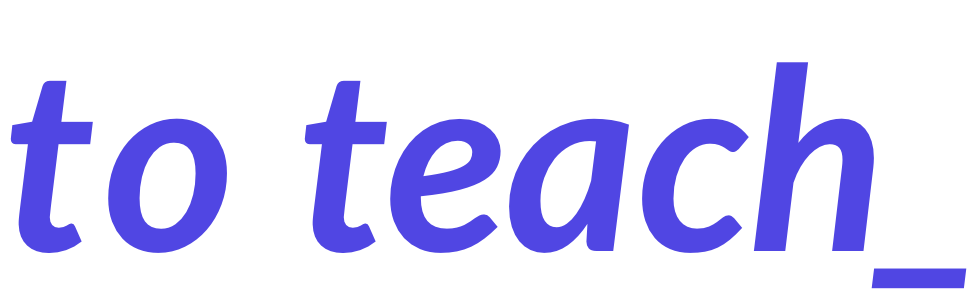Tiere in unserer Sprache: Redewendungen und Sprichwörter
In der deutschen Sprache gibt es viele Ausdrücke und Sprüche, die unseren Alltag bunter machen. Oft spielen Tiere darin eine Hauptrolle. Diese besonderen Sätze nennt man Redewendungen oder Sprichwörter. Sie haben meistens eine übertragene Bedeutung, das heißt, sie meinen etwas anderes, als die Wörter auf den ersten Blick aussagen. Wenn jemand sagt, er sei „hundemüde“, dann bellt er nicht oder wedelt mit dem Schwanz, sondern er ist einfach sehr, sehr müde.
Die bunte Welt der Tier-Redewendungen
Redewendungen sind feste Wortverbindungen, die eine bestimmte Bedeutung haben. Diese Bedeutung kann man oft nicht verstehen, wenn man nur die einzelnen Wörter übersetzt. Sprichwörter sind kurze, einprägsame Sätze, die eine Lebensweisheit oder eine allgemeine Erfahrung ausdrücken. In vielen dieser sprachlichen Bilder kommen Tiere vor. Man kann „stark wie ein Bär“ sein oder „schlau wie ein Fuchs“. Diese Vergleiche helfen uns, Eigenschaften von Menschen besser zu beschreiben.
„Viele Redewendungen mit Tieren sind schon sehr alt und werden von Generation zu Generation weitergegeben.“
Wenn jemand „die Katze aus dem Sack lässt“, dann verrät er ein Geheimnis. Das hat nichts mit einer echten Katze zu tun, die aus einem Sack springt. Es bedeutet, dass eine Überraschung oder eine bisher unbekannte Information preisgegeben wird. Tiere werden in solchen Ausdrücken benutzt, um eine Situation anschaulich und lebendig darzustellen. Manchmal ist es auch lustig, sich vorzustellen, was die Redewendung wörtlich bedeuten würde.
Warum gerade Tiere?
Tiere spielen schon immer eine wichtige Rolle im Leben der Menschen. Früher lebten die Menschen noch viel enger mit Haus- und Nutztieren zusammen. Sie beobachteten das Verhalten der Tiere genau. Dabei fielen ihnen bestimmte Eigenschaften auf: Der Esel galt als stur, die Biene als fleißig und der Löwe als mutig. Diese Beobachtungen flossen in die Sprache ein. So entstanden viele Redewendungen, in denen Tiere bestimmte menschliche Charakterzüge oder Verhaltensweisen verkörpern.
„Tiere in Redewendungen machen die Sprache bildhafter und ausdrucksstärker.“
Wenn man zum Beispiel sagt, jemand „macht aus einer Mücke einen Elefanten“, dann bedeutet das, dass diese Person eine kleine Sache viel größer und wichtiger darstellt, als sie eigentlich ist. Die Mücke steht hier für etwas Kleines und Unbedeutendes, der Elefant für etwas Großes und Eindrucksvolles. Solche Bilder helfen, komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich auszudrücken. Die Tiere dienen als Symbole, die jeder kennt und mit denen jeder bestimmte Vorstellungen verbindet.
Bekannte tierische Ausdrücke und ihre Geschichten
Es gibt unzählige Redewendungen und Sprichwörter mit Tieren. Einige davon sind sehr bekannt. Wenn jemand zum Beispiel „Schwein gehabt“ hat, dann hatte er unerwartetes Glück. Dieser Ausdruck kommt möglicherweise daher, dass früher bei Wettbewerben der Verlierer manchmal als Trostpreis ein Schwein bekam. Was zuerst wie Pech aussah, war also doch ein Gewinn.
Ein anderer bekannter Spruch ist „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“. Das bedeutet, dass man zwei Dinge gleichzeitig erledigt oder zwei Probleme mit einer einzigen Handlung löst. Man kann sich gut vorstellen, wie jemand versucht, mit einer Fliegenklatsche gleich mehrere lästige Fliegen zu erwischen.
Wenn jemand „Krokodilstränen weint“, dann täuscht er Trauer nur vor. Man glaubte früher, dass Krokodile beim Fressen ihrer Beute weinen würden. Ihre Tränen sind aber keine Zeichen von Mitleid, sondern dienen der Reinigung ihrer Augen.
Die Redewendung „den Bock zum Gärtner machen“ benutzt man, wenn man jemandem eine Aufgabe gibt, für die er völlig ungeeignet ist und bei der er wahrscheinlich Schaden anrichten wird. Ein Ziegenbock in einem Garten würde vermutlich alle Pflanzen anfressen, anstatt sie zu pflegen.
Diese tierischen Ausdrücke sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprache. Sie machen sie lebendiger und zeigen, wie eng die Beobachtung der Natur und der Tiere mit unserer Kultur und Kommunikation verbunden ist.