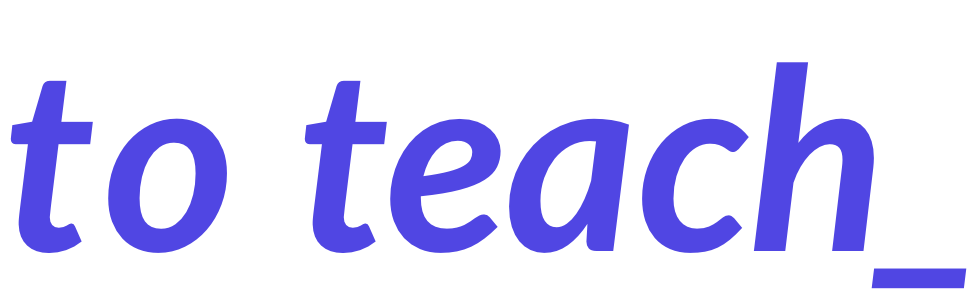Diskriminierungssensibler Unterricht: Sprache - Kontextwissen (Oberstufe)
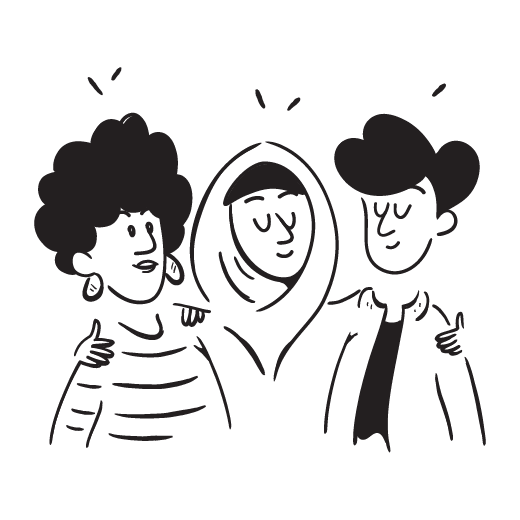
Du Spast!
Die ist sicher an den Rollstuhl gefesselt.
Er leidet an einer Behinderung.
Menschen mit Behinderung sind eine Belastung für die Gesellschaft.
Beurteile diese Aussagen. Kann man das sagen oder eher nicht? Begründe.
Ableismus: Definition und Beispiele
Ableismus bezeichnet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Diese Diskriminierung kann sich in verschiedenen Formen äußern, wie zum Beispiel durch abwertende Sprache oder unerwünschtes Mitleid. Ein Beispiel ist, wenn Menschen mit Behinderungen in beruflichen Kontexten als weniger leistungsfähig angesehen werden und trotz geeigneter Qualifikationen den Job nicht bekommen. Auch die mediale Darstellung ist oft einseitig und stereotyp, was die gesellschaftliche Wahrnehmung beeinträchtigt.
Beispiele: Ein Rollstuhlfahrer, der für alltägliche Tätigkeiten übermäßig gelobt wird, oder die mangelnde Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden.
Quelle: Focus Online
Prüfe, ob du alles verstanden hast.
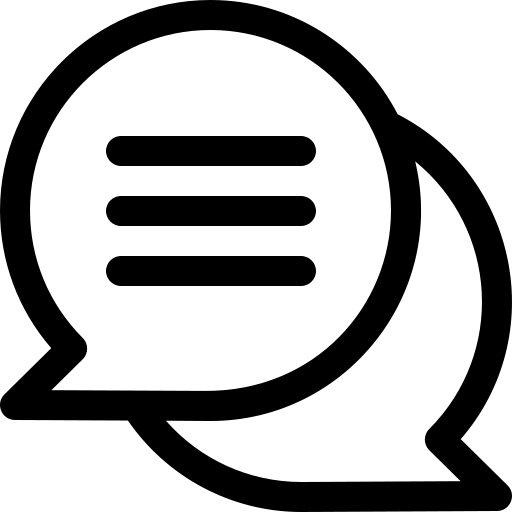
Ebenen der sprachlichen Diskriminierung
Diskriminierung durch Sprache kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Hier die wichtigsten und ihre Bedeutung:
- Benennung: Auf der Wort- und Begriffsebene werden einzelne Wörter genutzt, die Personen oder Gruppen einer Minderheit benennen (im Sinne einer Fremdbezeichnung) und dabei oft herabsetzen oder beleidigen, z. B. "Weib".
- Zuschreibung: Einer Person oder Gruppe werden z. B. stereotype Eigenschaften zugeschrieben, z. B. "Alle Fußballerinnen sind lesbisch."
- Phrasen & Redewendungen: Phrasen oder Sprichwörter (auch Witze, Stereotype und Vorurteile), die Personen oder Gruppen von Minderheiten ausgrenzen, herabsetzen oder beleidigen, z. B. "Ein Mann, ein Wort - Eine Frau, viele Worte."
- Auslassung: Eine Form der sprachlichen Ausgrenzung oder des Ausschlusses einer (Minderheiten-)Gruppe, z. B. "Wer kein Bier trinkt, ist kein echter Fan."
- Argumentation: Auf Grundlage von "Argumenten" (oft Scheinargumente) werden Personen oder Gruppen einer Minderheit diskriminiert, z. B. "Du kannst nicht Auto fahren, weil du eine Frau bist."
Die Ebenen sind nicht immer trennscharf, denn Diskriminierung passiert oft auf mehreren Ebenen. Außerdem muss der Kontext der Aussagen beachtet werden, z. B. handelt es sich um eine Selbst- oder Fremdbezeichnung? Wer spricht (nicht)? Wer spricht mit wem? Wer wird (nicht) gehört?
Hinweise zu Selbst- und Fremdbezeichnung: Menschen benutzen viele verschiedene Begriffe für ihre Identitäten und Selbstbezeichnungen – auch Menschen innerhalb ein und derselben Gruppe. Da Sprache einem ständigen Wandel unterworfen und eng mit Identitäten, Eigenschaften, Marginalisierung und politischer Mobilisierung verbunden ist, kann es keine dauerhaften verbindlichen Definitionen oder Sprachregelungen geben.
Tipps, die du beachten kannst: In der Regel sollten Selbstbezeichnungen Vorrang gegenüber Fremdbezeichnungen erhalten.
Grundsätzlich gilt es, die Selbstdefinition einer Person zu respektieren. Dennoch kann nicht daraus geschlossen werden, dass andere Menschen die gleiche Bezeichnung auch so verstehen oder sogar angemessen finden.
Welche Form der sprachlichen Diskriminierung könnte passen?
Würdest du dem Ergebnis zustimmen oder nicht?
Bist behindert?
Der Ausdruck "Bist behindert?" wird oft als Beleidigung verwendet, um jemanden als unfähig oder minderwertig darzustellen. Die Herkunft des Begriffs liegt in der medizinischen Bezeichnung von Menschen mit Einschränkungen. Diese Ausdrucksweise ist diskriminierend, da sie Behinderung als etwas Negatives und Minderwertiges darstellt und die betroffenen Personen auf ihre Beeinträchtigung reduziert.
Quelle: Kompetenznetzwerk DEKI
an einer Behinderung leiden
Die Formulierung "an einer Behinderung leiden" suggeriert, dass eine Behinderung zwangsläufig mit Leid und negativem Erleben verbunden ist. Diese Ausdrucksweise ist diskriminierend, da sie Menschen mit Behinderungen als Opfer darstellt und ihre Lebensqualität herabsetzt. Menschen mit Behinderungen können ein erfülltes und glückliches Leben führen, und die Betonung auf "Leiden" negiert diese Möglichkeit.
Quelle: Agile
an den Rollstuhl gefesselt
Die Formulierung "an den Rollstuhl gefesselt" impliziert, dass der Rollstuhl eine Einschränkung oder ein Gefängnis ist. Tatsächlich ist der Rollstuhl ein Hilfsmittel, das vielen Menschen Mobilität und Unabhängigkeit ermöglicht. Diese Ausdrucksweise ist diskriminierend, da sie den Rollstuhl und damit die Lebenssituation der betroffenen Personen negativ darstellt und sie auf ihre Behinderung reduziert.
Quelle: Der Standard