
Grundlagen der Argumentation
Zielsetzung:
Das Ziel des Arbeitsblattes ist es, dass die Lernenden sich mit den Grundlagen der Argumentation auseinandersetzen. Sie sollen die Bestandteile einer Argumentation analysieren und verstehen, also Behauptung, Begründung und Voraussetzung. Darüber hinaus sollen die Lernenden Kriterien für eine gelungene Argumentation entwickeln und diese anwenden können.
Inhalte und Methoden:
Das Arbeitsblatt führt in das Thema Argumentation ein und beleuchtet dessen Relevanz im Alltag. Anhand eines Videos und weiterer Materialien werden verschiedene Gesprächsformen und deren Ziele analysiert. Die Lernenden erarbeiten die grundlegenden Elemente einer Argumentation und wenden diese auf einen Beispieltext an. In Partnerarbeit entwickeln die Lernenden Kriterien für eine gelungene Argumentation und ordnen diese Kriterien zu.
Kompetenzen:
- Die Lernenden können verschiedene Gesprächsformen und deren Ziele unterscheiden.
- Die Lernenden können die Elemente einer Argumentation identifizieren und analysieren.
- Die Lernenden können Kriterien für eine gelungene Argumentation formulieren und anwenden.
Zielgruppe und Niveau:
Ab Klasse 8
153 other teachers use this template
Target group and level
Ab Klasse 8
Subjects
Grundlagen der Argumentation
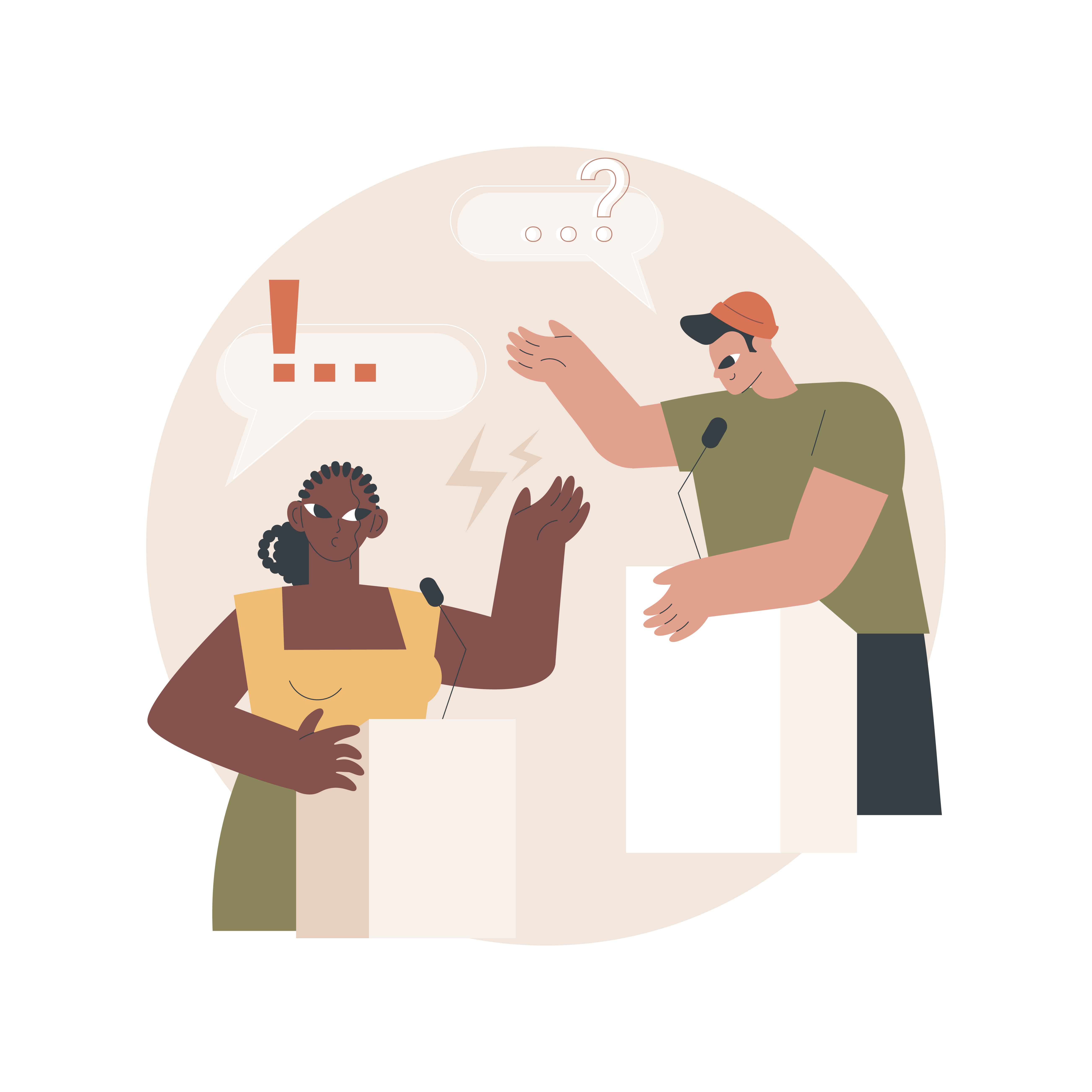

Grundlagen der Argumentation
In unserem Alltag sind wir ständig von Argumentationen umgeben: in Diskussionen mit Freund:innen, in den Medien, in der Werbung und sogar in der Schule. Argumentieren ist eine grundlegende Fähigkeit, um eigene Standpunkte zu vertreten, andere zu überzeugen und kritisch zu hinterfragen. Diese Unterrichtseinheit soll dir helfen, Argumentationen zu verstehen, zu analysieren und selbst überzeugende Argumente zu entwickeln.
📋 Arbeitsauftrag: Schaue das folgende Video aufmerksam und mache dir Notizen zu den folgenden Fragen:
- Was ist in diesem Gespräch passiert?
- Weshalb ist ein Konflikt entstanden?
- Wie haben sich die Gesprächspartner:innen verhalten?
- Was war das Ziel der Gesprächspartner:innen?
Kurze Besprechung der Ergebnisse in der Lerngruppe.
Die vielfältigen Formen des Miteinander-Sprechens: Ein Fundament menschlicher Interaktion
Das Miteinander-Sprechen ist ein zentraler Pfeiler menschlicher Interaktion und gestaltet unser Zusammenleben in unzähligen Facetten. Es existiert nicht in einer einzigen Form, sondern entfaltet sich in einer beeindruckenden Vielfalt, die von der Intention der Sprechenden, dem Kontext der Situation und den angestrebten Zielen abhängt.
Beginnend mit dem Dialog, der oft als Idealform gilt und durch gleichberechtigten Austausch sowie das Streben nach gemeinsamem Verständnis charakterisiert ist, begegnen wir der Diskussion, in der unterschiedliche Standpunkte vertreten und durch Argumente untermauert werden, mit dem Ziel der Überzeugung oder der Findung der besten Lösung. Eine formalisierte Variante der Diskussion stellt die Debatte dar, die klaren Regeln folgt und oft öffentlich ausgetragen wird. Der Begriff Gespräch hingegen dient als Oberbegriff für jede Form der verbalen Interaktion, sei sie nun informeller Natur oder eine tiefgründige Auseinandersetzung.
In spezifischen Situationen treten weitere Formen in den Vordergrund. Die Verhandlung beispielsweise zielt auf eine Einigung zwischen Parteien mit unterschiedlichen Interessen ab, während der Small Talk eine lockere, unverbindliche Konversation zur sozialen Kontaktpflege darstellt. Auch der Monolog, insbesondere der äußere, bei dem eine Person ununterbrochen spricht, prägt Kommunikationssituationen.
Darüber hinaus existiert eine breite Palette weiterer Arten des Miteinander-Sprechens. Das informelle Gespräch kennzeichnet ungezwungene Unterhaltungen ohne festes Ziel. Im Überzeugungsgespräch liegt der Fokus auf der Beeinflussung von Meinungen oder Verhalten, und das motivierende Gespräch zielt darauf ab, den Gesprächspartner zu ermutigen. In schwierigen Zeiten spielt das tröstende Gespräch eine wichtige Rolle, ebenso wie das idealerweise konstruktive kritische Gespräch. Anerkennung findet ihren Ausdruck im lobenden Gespräch.
Spezifische Kontexte bringen weitere Formen hervor, wie das zielgerichtete Verkaufsgespräch, das beratende Beratungsgespräch, das strukturierte Feedback-Gespräch und das kreative Brainstorming. Auch das Interview, als gezieltes Frage-Antwort-Spiel, das auf Informationsgewinnung abzielt, und das auf den Aufbau von Kontakten ausgerichtete Netzwerkgespräch sind wichtige Formen. Schließlich begegnen uns das Beschwerdegespräch, in dem Unzufriedenheit geäußert wird, und das humorvolle Gespräch, das primär der Erheiterung dient.
Diese Vielfalt an Arten des Miteinander-Sprechens verdeutlicht die Komplexität und Reichhaltigkeit menschlicher Kommunikation. Ein tieferes Verständnis dieser Formen ermöglicht es uns, bewusster zu interagieren, unsere Kommunikationsziele effektiver zu verfolgen und die Qualität unserer Beziehungen zu verbessern. Die Wahl der passenden Gesprächsform in der jeweiligen Situation ist ein entscheidender Faktor für erfolgreiche und erfüllende verbale Interaktionen.
Austausch über die dargestellten Inhalte der Mindmap. Die Schüler:innen sollen mit Hilfe der Mindmap die nächste Aufgabe bearbeiten. Deswegen ist es wichtig, dass die Mindmap ausführlich besprochen wird und die Ziele der im Text genannten Gesprächsarten erklärt werden.
📋 Arbeitsauftrag Einzelarbeit: Überleg dir die Ziele der abgebildeten Gesprächsarten. Worauf sollen diese abzielen?
Ein Beispiel zur Orientierung:
- Zwingen: Durchsetzung des eigenen Willens ohne Rücksicht auf die Argumente anderer.
- Überreden: Beeinflussung des Gegenübers durch emotionale Appelle oder unsachliche Argumente.
- Überzeugen: Beeinflussung des Gegenübers durch logische Argumente und nachvollziehbare Begründungen.
| Art des Miteinander-Sprechens | Ziel des Gesprächs |
|---|---|
| Form des Miteinander-Sprechens | Ziel des Gesprächs |
|---|---|
| Dialog | Gemeinsames Verständnis |
| Diskussion | Überzeugung / Lösung finden |
| Debatte | Öffentlicher Austausch unter Regeln |
| Gespräch | Verbalen Interaktion |
| Verhandlung | Einigung erzielen |
| Small Talk | Soziale Kontaktpflege |
| Monolog | Ununterbrochenes Sprechen |
| Informelles Gespräch | Ungezwungene Unterhaltung |
| Überzeugungsgespräch | Meinungen/Verhalten beeinflussen |
| Motivierendes Gespräch | Ermutigung |
| Tröstendes Gespräch | Trost spenden |
| Kritisches Gespräch | Konstruktive Kritik |
| Lobendes Gespräch | Anerkennung ausdrücken |
| Verkaufsgespräch | Produkt/Dienstleistung präsentieren |
| Beratungsgespräch | Beratung und Unterstützung |
| Feedback-Gespräch | Rückmeldung geben |
| Brainstorming | Kreative Ideenentwicklung |
| Interview | Informationsgewinnung |
| Netzwerkgespräch | Kontakte aufbauen |
| Beschwerdegespräch | Unzufriedenheit äußern |
| Humorvolles Gespräch | Erheiterung |

👥 Arbeitsauftrag Partnerarbeit: Besprich deine Ergebnisse mit deinem Sitznachbarn / deiner Sitznachbarin.
✒️ Hier findest du Platz für eventuelle Fragen und Anregungen.
Anschließende Besprechung der Ergebnisse in der Lerngruppe.
.png?alt=media&token=3ba84177-96ef-4bb8-ab57-25ffc36f2689)
Was ist Argumentieren?
Behauptung, Begründung, Voraussetzung
📋 Arbeitsauftrag: Lies den folgenden Text aufmerksam.
Achte auf die folgende Punkte und versuche diese in dem Text zu erkennen:
- Behauptung: Eine These oder Aussage, die vertreten wird.
- Begründung: Die Stützung der Behauptung durch Fakten, Beispiele oder logische Schlüsse.
- Voraussetzung (Prämisse): Eine unausgesprochene Annahme, die die Argumentation trägt.
Sind Frauen die besseren Führungskräfte?
In der Diskussion über Führungskräfte stellen sich viele die Frage, ob Frauen die besseren Führungspersönlichkeiten sind. Es gibt Argumente, die dafür sprechen, und solche, die dagegen sprechen. Ein wichtiger Punkt, der für Frauen als Führungskräfte spricht, ist ihre Fähigkeit zur Empathie. Frauen sind oft einfühlsam und können sich gut in die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter:innen hineinversetzen, was zu einem besseren Arbeitsklima führt. Ein weiteres Argument für Frauen in Führungspositionen ist ihre Kommunikationsstärke. Sie sind oft klarer und transparenter in ihrer Kommunikation, was Missverständnisse reduziert und die Teamarbeit fördert. Zudem neigen Frauen dazu, weniger hierarchisch zu denken und mehr auf Zusammenarbeit zu setzen, was zu kreativeren Lösungsansätzen führen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch Argumente, die gegen Frauen als Führungskräfte sprechen. Ein häufig genanntes Argument ist der angebliche Mangel an Durchsetzungsfähigkeit. Frauen wird oft nachgesagt, weniger hart und entscheidungsfreudig zu sein, was in kompetitiven Geschäftsumfeldern als Nachteil angesehen wird. Ein weiteres Argument ist die Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele Frauen müssen sich zwischen Karriere und Familie entscheiden, was ihre Aufstiegschancen beeinträchtigen kann. Schließlich gibt es auch strukturelle Hürden, wie die sogenannte „Gläserne Decke“, die Frauen daran hindert, in oberste Führungsebenen aufzusteigen. Trotz dieser Argumente ist klar, dass das Geschlecht allein nicht über die Qualität einer Führungskraft entscheidet. Es ist wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen die Möglichkeit haben, ihre Stärken in Führungspositionen einzubringen, und dass Unternehmen vielfältige und inklusive Strukturen schaffen, um das Potenzial aller Führungskräfte voll auszuschöpfen. Letztlich sollte die Fähigkeit, Menschen zu motivieren und ein Team zu leiten, im Vordergrund stehen, unabhängig vom Geschlecht.
| Behauptung | Begründung | Voraussetzung |
|---|---|---|
✒️ Hier findest du Platz für eventuelle Ergänzungen, die während der Besprechung genannt werden.
Analyse des Textes: "Sind Frauen die besseren Führungskräfte?"
Der Grundlagentext beschäftigt sich mit der Frage, ob Frauen die besseren Führungskräfte sind. Diese Frage wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und sowohl positive als auch negative Aspekte werden diskutiert.
1. These
Die zentrale These des Grundlagentextes lautet, dass Frauen möglicherweise die besseren Führungskräfte sind. Diese These wird durch verschiedene Argumente gestützt, die sowohl auf Studien als auch auf Beobachtungen in der Praxis basieren.
2. Argumente
a. Positive Argumente
Empathie und Mitgefühl: Frauen werden oft als empathischer und mitfühlender beschrieben. Studien zeigen, dass diese Eigenschaften für Führungskräfte wichtig sind, da sie helfen, ein respektvolles und unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Frauen bringen diese Eigenschaften laut Studien doppelt so häufig mit wie Männer.
Kooperativer Führungsstil: Frauen neigen dazu, einen kooperativen Führungsstil zu bevorzugen. Dies bedeutet, dass sie Entscheidungen weniger hierarchisch treffen und ihre Mitarbeiter stärker in Entscheidungsprozesse einbinden. Ein kooperativer Ansatz kann das Team stärken und zu besseren Ergebnissen führen.
Krisenmanagement: Frauen sind oft besonders gut darin, Krisen zu managen. Während der Corona-Pandemie haben weibliche Führungskräfte durch ihre empathische und kooperative Art effektive Lösungen gefunden, was ihre Fähigkeiten im Krisenmanagement unterstreicht.
b. Negative Argumente
Traditionelle Rollenbilder: Frauen in Führungspositionen werden oft mit traditionellen Rollenbildern und Vorurteilen konfrontiert, die ihre Autorität schwächen können. Dies kann dazu führen, dass sie weniger ernst genommen werden und es ihnen schwerer fällt, sich durchzusetzen.
Durchsetzungsfähigkeit: Es gibt das Vorurteil, dass Frauen weniger durchsetzungsfähig sind. In bestimmten Situationen kann dies als Nachteil angesehen werden, da Durchsetzungsfähigkeit manchmal erforderlich ist, um klare und schnelle Entscheidungen zu treffen.
Gläserne Klippe: Frauen in Führungspositionen sind oft mit der sogenannten "gläsernen Klippe" konfrontiert, was bedeutet, dass sie häufiger in Krisensituationen eingesetzt werden. Diese Positionierung kann ihre langfristige Erfolgsrate beeinträchtigen und zusätzlichen Druck erzeugen.
3. Beispiel
Der Text verweist auf die Corona-Pandemie als Beispiel für erfolgreiches Krisenmanagement durch weibliche Führungskräfte. In dieser globalen Krise haben viele Frauen durch ihre empathische und kooperative Herangehensweise effektive Lösungen gefunden, was zeigt, dass ihre Fähigkeiten in schwierigen Zeiten besonders wertvoll sind.
4. Prämisse
Die Prämisse des Grundlagentextes ist, dass die Qualität einer Führungskraft nicht ausschließlich vom Geschlecht abhängt. Vielmehr sind individuelle Führungsqualitäten und die spezifischen Anforderungen des Unternehmens entscheidend. Führungskräfte sollten ihre Teams respektvoll behandeln, kompetente Entscheidungen treffen und flexibel sowie empathisch reagieren können. Unabhängig vom Geschlecht sollten Mitarbeiter sich wohlfühlen, sich entfalten können und die Gewissheit haben, dass die Führungskraft das Beste für das Unternehmen und die Mitarbeiter anstrebt.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grundlagentext eine ausgewogene Betrachtung der Frage bietet, ob Frauen die besseren Führungskräfte sind. Er hebt sowohl positive als auch negative Aspekte hervor und betont, dass letztlich individuelle Qualitäten und nicht das Geschlecht entscheidend für gute Führung sind.
Gemeinsame Besprechung der Ergebnisse in der Lerngruppe.
.png?alt=media&token=3b15ebb8-c25e-480f-8f98-87166daa221b)
Kriterien für eine gelungene Argumentation
Arbeitsauftrag: Sammle zusammen mit deinem Sitznachbarn / deiner Sitznachbarin Kriterien für eine gelungene Argumentation.
✒️ Hier findest du Platz für eure Überlegungen.
So baust du eine gute Argumentation:
- Klare Aussage (These): Sag deutlich, was du denkst. Nicht drumherumreden! Zum Beispiel: "Wir sollten mehr für den Umweltschutz tun."
- Gute Gründe (Argumente): Warum denkst du das? Deine Gründe müssen zu deiner Aussage passen und vernünftig sein. Beispiel: "Der Klimawandel ist ein großes Problem, das uns alle betrifft."
- Beweise (Belege): Zeig, dass deine Gründe stimmen. Das können Fakten sein (Zahlen, Daten), Beispiele oder Meinungen von Experten. Wichtig ist, dass deine Beweise verlässlich sind.
- Logischer Aufbau: Deine Argumente müssen zusammenpassen und deine Aussage unterstützen. Es sollte klar sein, wie du von deinen Gründen zu deiner Meinung kommst.
- Publikum beachten: Überlege, wem du das erzählst. Was wissen die Leute schon? Was könnten sie dagegen sagen? Deine Argumente sollten zu deinem Publikum passen.
- Gegenargumente beachten: Überlege, was andere gegen deine Meinung sagen könnten. Wenn du darauf schon eine Antwort hast, ist deine Argumentation stärker. Sei dabei fair und verdreh nicht die Meinung der anderen.
Wann eine Argumentation nicht gut ist:
- Unklare Aussage: Wenn man nicht versteht, was du eigentlich willst.
- Schlechte Gründe: Gründe, die nichts mit deiner Aussage zu tun haben oder keinen Sinn ergeben.
- Fehlende Beweise: Wenn du einfach nur etwas behauptest, aber nichts dafür hast.
- Logik-Fehler (Denkfehler): Wenn deine Argumente keinen Sinn ergeben oder du unfaire Tricks benutzt.
Beispiele:
- Persönliche Angriffe: Jemanden schlechtmachen, statt über das Thema zu reden.
- Verdrehen der Meinung: So tun, als ob der andere etwas Dummes gesagt hätte, um es leichter zu kritisieren.
- Im Kreis reden: Deine Aussage mit deiner Aussage begründen.
- Falsche Wahl: So tun, als gäbe es nur zwei Möglichkeiten, obwohl es mehr gibt.
- Schnelle Schlüsse: Von einem Beispiel auf alle schließen.
- Falsche Ursache: Denken, nur weil etwas vorher passiert ist, ist es auch die Ursache.
- Alle machen das: Denken, etwas ist richtig, nur weil viele es tun.
- Falsche Experten: Sich auf jemanden berufen, der sich in dem Thema gar nicht auskennt.
- Publikum ignorieren: Wenn du nicht darauf achtest, was die anderen denken oder wissen.
- Gegenargumente ignorieren oder unfair behandeln: Wenn du so tust, als gäbe es keine andere Meinung oder die Meinung der anderen schlechtmachst.
📋 Arbeitsauftrag: Ordne in dieser Aufgabe die Kriterien in die Felder ein.
Gemeinsame Besprechung der Ergebnisse in der Lerngruppe.